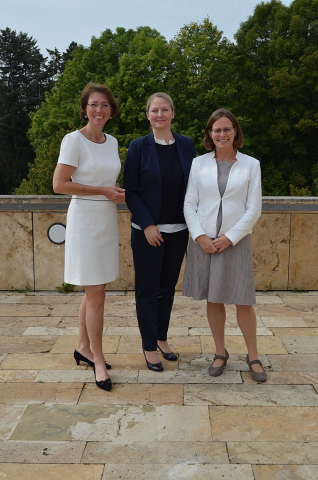Hier finden Sie eine Übersicht über alle zurückliegenden Veranstaltungen des Instituts samt deren jeweiligem Thema. Weitere Informationen erhalten Sie durch Aufruf der entsprechenden Veranstaltung.
Am Dienstag, den 24. September 2019, veranstaltete das Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht (ineges) die wissenschaftliche Tagung:
„Mehrwert der Selbstverwaltung“
Angesichts der abzusichernden Risiken kommt der Sozialversicherung eine herausragende gesellschaftliche Bedeutung zu. Ihre Ausgestaltung ist Gegenstand konstant wiederkehrender öffentlicher Debatten und politischer Aushandlungsprozesse. Dies gilt ebenso für die Selbstverwaltung als ihr tragendes Organisationsprinzip. Muss sie gestärkt werden, wie der Name des Reformgesetzes aus der letzten Legislaturperiode nahelegt? Oder sind Einschränkungen notwendig, wie sie in der aktuellen Legislaturperiode diskutiert werden? Antworten hierauf brauchen zunächst eine Vergewisserung darüber, welche Erwartungen an die Selbstverwaltung als Organisationsform bestehen.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Jahrestagung stehen diese Erwartungen – und wie sie erfüllt werden oder erfüllt werden könnten – im Mittelpunkt. Den tatsächlichen oder auch nur möglichen Mehrwert der sozialen Selbstverwaltung wollen wir aus verschiedenen Perspektiven in den Blick nehmen. Dafür wenden wir uns den Themenfeldern Parafiskalität, öffentlich-rechtliche Selbstregulierung, der spezifischen Stellung der Selbstverwaltung zwischen Markt und Staat, ihren partizipatorischen Elementen und ihren spezifischen Verfahrens- und Kommunikationsformen zu.
Das detaillierte Programm sowie Hinweise zur Anmeldung können Sie dem beigefügten Programmflyer entnehmen. Wir würden uns freuen, Sie im September bei uns an der Goethe-Universität in Frankfurt begrüßen zu dürfen!
Prof. Dr. Astrid Wallrabenstein (Geschäftsführende Direktorin) und Prof. Dr. Indra Spiecker gen. Döhmann, LL.M. (Georgetown Univ.) (Direktorin)
Tagungsmaterialien
PD Dr. Peter Collin
Mehrwert der Selbstverwaltung? Die Anfänge der Krankenversicherung
Prof. Dr. Franz Reimer
Mehrwert durch öffentlich-rechtliche Selbstregulierung
Prof. Dr. Axel Olaf Kern
Mehrwert der Selbstverwaltung zwischen Markt und Staat: Bollwerk, Mittler oder verzichtbar?
Franz Knieps
Kommentar
Prof. Dr. Peter Axer
Mehrwert durch Parafiskalität
Dr. Bernard Braun
Mehrwert durch spezifische Prozesse der Kommunikation und des Wissensmanagements
Prof. Dr. Wolfgang Schroeder
Mehrwert durch Partizipation
Dr. Doris Pfeiffer
Kommentar
Eindrücke von der Tagung
Am 12. März 2019 veranstaltete das Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht beim Verband der Ersatzkassen e.V. in Berlin die wissenschafliche Tagung:
„Ein Europa der Patientinnen und Patienten? – Status quo und Herausforderungen grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung“
Dieses Mal widmen wir uns dem Thema Patientenmobilität. Angesichts der Bedeutung des Wirtschaftssektors „Gesundheitswesen“ nicht nur im nationalen, sondern auch im europäischen Raum stehen die Patientinnen und Patienten inmitten eines Spannungsfeldes zwischen (Wohlfahrts-)Staat und (Binnen-)Markt. In diesem Kontext verfolgt die sog. Patientenrichtlinie (RL 201124/EU) das Ziel, den freien Zugang zu grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung in der Europäischen Union für alle Patientinnen und Patienten zu erleichtern. Fünf Jahre sind seit dem Ablauf der Umsetzungsfrist für die Richtlinie vergangen – ein guter Zeitpunkt, um den Status quo einer kritischen Bewertung zu unterziehen. Dabei widmen sich die Beiträge unter anderem folgenden Fragen: Wie ist es um die Umsetzung der Patientenrichtlinie in Deutschland und den Mitgliedstaaten bestellt? Wie stark und von wem werden die gewährleisteten Rechte wahr-genommen? Welche Hindernisse stehen einer grenzüberschreitenden Nutzung von Gesundheitsleistungen entgegen und welche Ungleichheiten bestehen hier weiterhin? Darüber hinaus wollen wir im Jahr der Europawahl den Blick auf die aktuellen gesundheitspolitischen Aktivitäten der Europäischen Union lenken und die Herausforderungen einer weiteren Vergemeinschaftung der Gesundheitspolitik am Beispiel der Patientenmobilität diskutieren.
Am 30. Oktober 2018 referierte und diskutierte Herr Prof. UAM Daniel Eryk Lach, LL.M. (EUV), Adam-Mieckiewicz-Universität Poznań über:
„Das System der Gesundheitsfürsorge in Polen – Organisation und aktuelle Entwicklungstendenzen“
Nach Art. 68 Abs. 2 der polnischen Verfassung von 1997 sichert die öffentliche Gewalt den Staatsangehörigen, unabhängig von deren materieller Lage, gleichen Zutritt zur Gesundheitsfürsorge zu, die aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Bedingungen und Umfang der Leistungen regelt das Gesetz. Professor Lach stellt die Akteure und Rechtsverhältnisse im polnischen System ebenso dar wie die aktuelle Tendenz zur [Re]Publizierung: die Befreiung unberechtigter Personen von der Pflicht, die beanspruchten Leistungen der Grundversorgung zu bezahlen, der Aufbau des Krankenhaus-Netzes und dessen pauschale Finanzierung, Anforderungen, an die Leistungserbringer, damit diese im Bereich der Rettungsdienste öffentlich-rechtliche Subjekte darstellen, und die Abkehr von der Kommerzialisierung der Leistungserbringer.
Am 18. September 2018 veranstaltete das Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht in den Räumen der Goethe-Universität Frankfurt die wissenschaftliche Tagung:
„Gesundheitsversorgung in Zeiten der Datenschutz-Grundverordnung“
Am 25. Mai 2018 trat die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Auch wenn sie im Prinzip ein europaweit harmonisiertes Regelungswerk für den Umgang mit personenbezogenen Daten schafft, so sind doch gerade im Gesundheitsbereich, in dem in besonderer Weise sensible Daten durch eine Vielzahl Beteiligter verarbeitet werden, viele Einzelfragen noch offen. Der deutsche Gesetzgeber hat bisher wenig zur Konkretisierung beigetragen, auch wenn erste Anpassungen nationaler Gesetze im Sozialdatenschutz erfolgt sind. Unbestimmte Rechtsbegriffe sowie weite Abwägungs- und Öffnungsklauseln auf der materiellrechtlichen Ebene einerseits und strikte prozedurale Verpflichtungen wie Datenschutzfolgeabschätzung, Nachweis- und Informationspflichten andererseits harren noch der konkreten Bestimmung und stellen Datenverarbeiter, Auftragsverarbeiter, Aufsichtsbehörden und Nutzer vor erhebliche praktische Probleme. Zudem ist nicht immer klar, welche Rechtsgrundlagen gerade im Online-Bereich weiterhin gelten. Die Jahrestagung lässt Akteure aus Wissenschaft, Praxis und Anwendung zu Wort kommen, welche Probleme bestehen und welche Lösungsmöglichkeiten angedacht werden können, um einen rechtssicheren Umgang mit Gesundheitsdaten unter dem Regelungsregime der DSGVO zu gewährleisten.
Tagungsmaterialien
Dr. Dirk Bieresborn, Richter am Bundessozialgericht:
Der Schutz von Gesundheitsdaten als Sozialdaten nach Inkrafttreten der DSGVO-Anpassungsgesetze
Prof. Dr. Roland Broemel, maîtrise en droit Goethe-Universität Frankfurt a.M.:
Big Data im Gesundheitswesen – Anwendungen und datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen
Tim Wybitul, Rechtsanwaltskanzlei Hogan Lovells:
Datenpannen unter der DSGVO – Herausforderung und Problembewältigung
Dr. Fruzsina Molnar-Gabor, Heidelberger Akademie der Wissenschaften:
Die Verarbeitung von Patientendaten in der Cloud unter den Bedingungen der DSGVO
Dr. Thomas Lapp, Rechtsanwaltskanzlei Dr. Lapp:
Auftragsdatenverarbeitung in der Cloud – Tücken im neuen SGB X und der DSGVO?
Dr. Nils Ipsen, LL.M. Rechtsanwaltskanzlei Lindenpartners:
Datenschutzrechtliche Zulässigkeit von Apps im Gesundheitswesen
Am 19. März 2018 veranstaltet das Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. (ineges) in den Räumlichkeiten des AOK-Bundesverbandes (Rosenthaler Straße 21 – 10178 Berlin) das Symposium:
„Zwischen den Säulen – Grenzfragen der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung“
Im Rahmen unserer halbjährlichen Tagung freuen wir uns wieder auf das Fachpublikum aus Gesundheitswesen, Politik und Rechtswissenschaft. Dieses Mal setzen wir uns mit den „Grenzfragen der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung“ auseinander und greifen zwei aktuelle Themen heraus:
Wahlmöglichkeiten im Beihilferecht
Seit dem 19. Dezember 2017 liegt der Hamburger Bürgerschaft der Entwurf für ein „Gesetz über die Einführung einer pauschalen Beihilfe zur Flexibilisierung der Krankheitsvorsorge“ vor. Damit soll ab August 2018 Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit eingeräumt werden, anstatt der traditionellen Beihilfe zu den tatsächlichen Krankheitskosten den hälftigen Beitrag einer gesetzlichen oder privaten Krankenvollversicherung als Beihilfepauschale zu wählen. Der Hamburger Senat möchte damit seine Fürsorgeleistungen ausgewogener gestalten und den veränderten krankenversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen seit 2008 Rechnung tragen. Ob und inwieweit durch diesen Schritt sowie gegebenenfalls weitere bundesrechtliche Änderungen eine echte Wahlfreiheit zwischen GKV und PKV für Beamtinnen und Beamte entsteht, welche Aspekte dafür oder dagegen sprechen und nicht zuletzt welche verfassungsrechtlichen Vorgaben zu beachten sind, wird im ersten Panel diskutiert.
Selbstzahler als Nichtzahler
Seit Einführung der Versicherungspflicht stellt der Umgang mit Nichtzahlern in PKV wie GKV eine Herausforderung dar. Die PKV scheint gegenwärtig mit dem Notlagentarif einen handhabbaren Ansatz gefunden zu haben. Größer scheint daher zurzeit das Problem in der GKV, in der (erneut) auflaufende Beitragsrückstände ungelöste Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen aufwerfen. Das zweite Panel will Ideen und Denkanstöße für mögliche Antworten liefern.
Tagungsmaterialien
Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg:
Das Hamburger Modell: Wahlmöglichkeit zwischen individueller und pauschalierter Beihilfe
Prof. Dr. Karl-Jürgen Bieback, Professor i.R., Universität Hamburg:
Wettbewerbsneutrales Beihilferecht als Auftakt für Wahlfreiheit zwischen GKV und PKV
Prof. Dr. em. Udo Steiner, Universität Regensburg, Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D.:
Verfassungsfragen anlässlich des Hamburger Modells
Nico Schumann, Fachbereichsleiter Zahlungsverkehrskonten, Vollstreckung, BKK VBU:
Selbstzahler als Nichtzahler: aktuelle Situation in der GKV
Prof. Dr. Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts, Kassel:
Notlagentarife und Badbanks: Anregungen für Beitragsausfälle im solidarischen System?
Am 12. September 2017 veranstaltete das Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. (ineges) in den Räumlichkeiten des House of Finance (HoF) (Theodor-W.-Adorno-Platz 3 – 60323 Frankfurt am Main) die Tagung:
„Compliance im Gesundheitswesen“
Die diesjährige Tagung greift die Debatte auf, die seit einigen Jahren vornehmlich als Kritik an bestimmten Formen der Zusammenarbeit oder des Verhältnisses zwischen Ärzten und anderen Leistungserbringern diskutiert wird und vor einem Jahr auch zur Einführung eines neuen Korruptionsstraftatbestandes ins StGB geführt hat. Allerdings soll sie in den umfassenderen Kontext normativer Verhaltenserwartungen an alle Beteiligten des Behandlungsgeschehens gestellt werden. Denn nicht nur Ärzte und andere Leistungserbringer, sondern – jeweils auf ihre Weise – auch Patienten oder Krankenkassen können die an sie gerichteten normativen Verhaltenserwartungen verfehlen.
Menschen handeln nach geschriebenen aber auch nach ungeschriebenen, teils auch unausgesprochenen Normen, die nicht immer widerspruchsfrei zueinander stehen. Normwidriges Verhalten kommt daher regelhaft vor. Debatten um die „richtigen“ Normen aber auch um geeignete oder bessere Durchsetzungsregime müssen daher immer wieder geführt werden.
Für das Gesundheitswesen scheint hieran ein besonderer Bedarf zu bestehen, wie die Vielzahl von Beratungsangeboten zum Compliance-Management andeutet. Allerdings kann die praxisorientierte Beratung zu den Hintergründen nicht vordringen.
Die Tagung soll hierzu einen interdisziplinären Beitrag liefern. Es sollen zum einen grundlegende Fragen des Compliance-Ansatzes aufgeworfen werden. Zum anderen sollen konkrete gesundheitspolitische Debatten zur Stärkung einer „guten Ordnung“ vorgestellt werden. Beim Thema Patientencompliance stellt sich die Frage, wie eine solche sichergestellt werden kann, ohne die Autonomie des Patienten aufzugeben. Schließlich soll in einem Podiumsgespräch reflektiert werden, welche Wirkungen Compliance-Konzepte zur Verwirklichung aber auch zur Veränderung eben dieser guten Ordnung haben.
Sie sind herzlich eingeladen, mit ausgewiesenen Wisenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diese und weitere Fragen zu diskutieren.
Tagungsmaterialien
Prof. Dr. Stefan Kühl:
Universität Bielefeld, Professur für Organisationssoziologie
Die Normalität der Regelabweichung
Dr. Sven Kette:
Universität Luzern, Soziologisches Seminar, Schwerpunkt Organisation und Wissen
Dysfunktionen organisationalen Compliance-Managements
Prof. Dr. Jürgen Taschke:
Rechtsanwalt, Frankfurt a.M.
Durch Kriminalisierung zur Entkriminalisierung: Bericht über einen Feldversuch der Pharmaindustrie
Prof. Dr. Ralf Kölbel:
LMU München, Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie
Compliance und institutionelle Korruption im Pharmavertrieb
Dr. Martin Sedlmayr:
FAU Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Medizinische Informatik
eHealth als Schlüssel für bessere Patientencompliance – technische Möglichkeiten und medizinische Herausforderungen
Jean Dietzel:
Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (iges), Berlin
Die neuen Player im Markt (kein Dokument verfügbar)
Dr. Yoan Hermstrüwer:
MPI Gemeinschaftsgüter, Bonn
Anreize und Nudging zur Patientencompliance: Eine juristische Betrachtung
Am 23. März 2017 veranstaltete das Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. (ineges) in den Räumlichkeiten des AOK-Bundesverbandes (Rosenthaler Straße 21 – 10178 Berlin) das Symposium:
„Das Selbstverwaltungsstärkungsgesetz – Rechtliche Auswirkungen auf Selbstverwaltung und Aufsicht“
Am 16. November 2016 hat das Bundeskabinett den Entwurf des GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes beschlossen. Ziel der Neuregelung ist es, die interne und externe Kontrolle sowie die Transparenz der Spitzenverbände der Selbstverwaltung zu verbessern. Nicht nur die gesetzlichen Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Ge- meinsame Bundesausschuss sehen durch den Entwurf ihre Selbstverwaltung in Gefahr.
Nach Diskussionen um Immobiliengeschäfte sowie die Höhe von Vergütungen und Altersbezügen wurden vor allem seitens der Politik Forderungen nach neuen Aufsichtsinstrumenten laut. Die Neuregelung sieht eine Stärkung der Kontrollrechte der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane vor. Die Transparenz soll u.a. durch die verpflichtende Einrichtung interner Kontrollmechanismen und durch zusätzliche externe Prüfungen der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung verbessert werden.
Ob der Kabinettsentwurf wirklich zu einer Stärkung oder gar zu einer Schwächung der Selbstverwaltung führt, ist ebenso wie die Rolle der Aufsicht in der GKV zentraler Bestandteil der Diskussion. Strittig sind etwa die Befugnisse, Satzungsänderungen anzuordnen oder eine „Entsandte Person für besondere Angelegenheiten“ einzusetzen. Auch aus verwaltungsrechtlicher Sicht stellen sich eine Reihe von Fragen.
Sie sind herzlich eingeladen, mit Expertinnen und Experten aus Rechtswissenschaft und Gesundheitswesen die Probleme sowie mögliche rechtspolitische Auswirkungen rund um den Gesetzesentwurf zu diskutieren.
Tagungsmaterialien
PD Dr. Peter Collin
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt a.M.
Die Rolle der Aufsicht in der GKV – eine rechtshistorische Bilanz
Thesenpapier / Folien
Prof. Dr. Stephan Rixen
Universität Bayreuth
Schwächung der Selbstverwaltung? – Die Rolle des GKV-Spitzenverbandes nach dem Selbstverwaltungsstärkungsgesetz
Thesenpapier / Folien
Prof. Dr. Otfried Seewald
Universität Passau
Kommentar und Diskussion
Thesenpapier
Dr. Gero-Falk Borrmann
Rechtsanwalt, Karlsruhe
Das neue Aufsichtsverfahren – Effektives Management gegen Rechtsverstöße am Beispiel der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
Thesenpapier / Folien
Hon. Prof. Dr. Karsten Scholz
Justiziar, Ärztekammer Niedersachsen
Kommentar und Diskussion
Thesenpapier
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rainer Pitschas
Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
Auswirkungen des Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes auf den Gemeinsamen Bundesausschuss
Thesenpapier
Dr. Kathrin Loer
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, FernUniversität in Hagen
Kommentar und Diskussion
Thesenpapier
Die Referate und Kommentare erscheinen in der Kranken- und Pflegeversicherung (KrV), Heft 4/2017 und 5/2017. Einen Tagungsbericht finden Sie in der NZS 2017, S. 413-417.
Am 23. Juni 2016 veranstaltete das Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht (ineges)an der Goethe-Universität Frankfurt die Tagung:
„Pflegequalität im Institutionenmix“
Mit dem im Januar 2016 in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetz II hat der Gesetzgeber umfassende Regelungen zur Qualitätssicherung in der Pflegeversicherung vorgenommen. Insbesondere die Umbildung der bisherigen Schiedsstelle Qualitätssicherung in den neuen Qualitätsausschuss stellt ein Novum dar. Aber weder wird ein Ausschuss allein die Dinge richten, noch kann dies seine Aufgabe sein. Pflegequalität ist vielmehr eine komplexe Herausforderung an alle Akteure und daher auch Aufgabe und Ziel der zahlreichen Regelungsebenen des Pflegesektors.
In diesem Sinne führt die Tagung des ineges diese verschiedenen Ebenen und Regulierungsansätze unter dem Motto des Institutionenmix zusammen. Welche alten und neuen Instrumentarien gibt es? Wie wirken sie zusammen oder auch nicht? Welche Bedarfe werden (noch) nicht befriedigt? Dieser Frage werden die Referentinnen und Referenten nachgehen.
Zu Beginn soll aber der Rahmen der Debatte durch die Erörterung konzeptionellen Grundfragen abgesteckt werden. Sowohl aus verfassungsrechtlicher Perspektive existieren Ansätze, Pflegequalität einzufordern, als auch aus ökonomischer Perspektive gibt es Grenzen der Steuerungsmöglichkeiten zu bedenken.
Diesen Grundfragen folgt die Betrachtung verschiedener institutioneller Bereiche: Anhand der Rolle der Krankenkassen sollen die Möglichkeiten der Qualitätssicherung durch Vertragsstrukturen in der gesetzlichen Pflegeversicherung diskutiert werden. Daran anschließend folgt eine Erörterung externer Regime, etwa der Heimaufsicht, zur Steuerung der Pflegequalität. Aber auch neue Impulse aus anderen Bereichen sollen aufgegriffen werden; nämlich Ansätze zur helfenden und fördernden Intervention als sozialstaatliches Instrument des Gewaltschutzes. Die Tagung endet mit einer Betrachtung des Gesetzentwurfs zur Reform der Pflegeberufe und welchen Beitrag die Generalismusdebatte zur Qualitätssicherung im Pflegesektor beisteuern kann.
Sie sind herzlich eingeladen, mit Expertinnen und Experten aus der Rechtswissenschaft und dem Gesundheitswesen, diese und weitere Fragen zu diskutieren.
Tagungsmaterialien
Eine Übersicht über die Referentinnen und Referenten sowie deren Beiträge können Sie dem zugehörigen Tagungsflyer entnehmen. In der NZS 2016, S. 858-861 finden Sie zudem einen Tagungsbericht.
Am 18. März 2016 veranstaltete das Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht (ineges) der Goethe-Universität Frankfurt in Berlin in den Räumen des VDEK das Symposium:
„Neues Vergaberecht für Gesundheitsleistungen“
Am 20.01.2016 hat das Bundeskabinett die Vergaberechtsmodernisierungsverordnung beschlossen. Als Mantelverordnung enthält sie eine Reihe von Verordnungen, die verschiedene Bereiche des öffentlichen Auftragswesens näher regeln sollen. Dies hat auch weitreichende Auswirkungen auf das Gesundheitswesen.
Erwägungsgrund 4 der neuen Vergabe-Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe entfacht erneut die Diskussion, ob Verträge, bei denen der öffentliche Auftraggeber keine Auswahlentscheidung trifft, dem Vergaberecht unterliegen. Diese Problematik ist vor allem im Gesundheitswesen von höchster Relevanz, ist doch umstritten, ob die gesetzlichen Krankenkassen Arzneimittelrabattvereinbarungen gem. § 130a Absatz 8 SGB V im „Open-House-Modell“ ausschreiben können. Bereits 2014 hat das OLG Düsseldorf dem EuGH die Fragen vorgelegt, ob eine Auswahlentscheidung notwendiges ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal eines öffentlichen Auftrages ist und welche Voraussetzungen dann für das Zulassungsverfahren ohne Auswahlentscheidung gelten. Antworten hierauf und Konsequenzen, auch unter den Bedingungen der neuen Vergaberechtsregelungen, gilt es zu diskutieren.
Die Reform des Vergaberechts wirkt sich auch auf medizinische Rehabilitationsleistungen aus. Auch sie werden bisher in offenen Zulassungssystemen und ohne Ausschreibung organisiert. Ob es bei dieser Praxis bleibt oder ob auch hier Änderungen durch die Vergaberechtsreform geboten sind, wird zweiter Themenblock des Symposiums sein.
Sie sind herzlich eingeladen, mit Expertinnen und Experten aus Rechtswissenschaft und Gesundheitswesen diese und weitere Fragen zu diskutieren.
Tagungsmaterialien
Eine Übersicht über die Redner und Beiträge der Tagung können Sie dem zugehörigen Tagungsflyer entnehmen.
Zudem finden Sie im Folgenden die Vortragsfolien von einigen der Referenten:
Am 30. September 2015 veranstaltete das Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht (ineges) der Goethe-Universität Frankfurt in Berlin die Tagung:
„Wer, womit und wozu: rechtswissenschaftliche Fragen an das neue Präventionsgesetz“
Prävention im Gesundheitsbereich ist ein Dauerthema, das auch die Gesetzgebung schon viele Jahre bewegt. Nun will der Bundestag ein Präventionsgesetz verabschieden, das Gesundheitsförderung und Prävention in allen Lebensbereichen stärken will. Eine Vielzahl von Akteuren bis hin zur privaten Kranken- und Pflegepflichtversicherung ist angesprochen, deren Kooperation verbessert werden soll. Eine zentrale Rolle kommt den gesetzlichen Krankenkassen zu. Die Ausgabenrichtwerte für Präventionsleistungen werden angehoben, neue Präventionsaufgaben – vor allem „in Lebenswelten“ – bestimmt und hierfür Handlungsvorgaben gemacht.
Ist hiermit eine erfolgversprechende Konzeption auf den Weg gebracht? Kann die gewünschte Kooperation gelingen? Ist sie überhaupt durch Bundesgesetz plan- und steuerbar? Wer trägt die Kosten der Gesundheitsförderung? Was spricht für – und was gegen – eine Finanzierung von Präventionsleistungen aus den Zusatzbeiträgen der gesetzlich Versicherten, denn Kostensteigerungen schlagen sich aufgrund der neuen Finanzierungsstruktur der gesetzlichen Krankenversicherung hier nieder?
Neben diesen umsetzungsorientierten Fragen darf und muss aber auch das politische Konzept, das dem Präventionsgesetz zugrunde liegt, hinterfragt werden. So konsensfähig der Wert und Nutzen einer gesunden Lebensführung sein mag, ist doch keineswegs ausgemacht, wie und mit welchen Mitteln gesetzliche Steuerung möglich und zulässig ist. Wie steht es um gesundheitliche Chancengleichheit? Gibt es schließlich Grenzen – ethischer oder verfassungsrechtlicher Art – die eine aktive Präventionspolitik beachten muss?
Sie sind herzlich eingeladen, mit Experten aus der Rechtswissenschaft diese und weitere Fragen zu diskutieren.
Tagungsmaterialien
Eine Übersicht über die Referentinnen und Referenten sowie deren Beiträge finden Sie im zugehörigen Tagungsflyer.